Diese Website benutzt technische Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.
Gefühle & Gedanken
Back to the roots
Je älter Alexa wird, desto größer wird die Sehnsucht nach ihrer Heimat. Zieht sie etwa zurück?
von Alexa von Heyden - 01.12.2021

Audioartikel

Die Audiodatei findet ihr am Ende des Textes.
Heimat ist da, wo dein Herz ist“, heißt es. Okay, dann liegt meins zweigeteilt auf der A 2. Die eine Hälfte sehnt sich nach meinem Wohnort Brandenburg, die andere nach Nordrhein-Westfalen, da wo ich geboren bin, meine Mutter und die Hälfte meiner Geschwister leben.
Ich bin selbst schuld, dass mein Herz zerrissen ist. Gleich nach dem Abiball packte ich meine Umzugskartons und wollte so schnell wie möglich nach Berlin. Ich wollte neue Leute kennenlernen, in den Clubs tanzen, in denen es richtig bumste, und ein Praktikum bei einem Modedesigner machen, um dann eine Weltkarriere zu starten, angesichts derer sich alle in meinem Heimatort mal schön warm anziehen konnten.
Über meine ehemaligen Klassenkamerad*innen, die in die Einliegerwohnung ihres Elternhauses zogen und zum Mittagessen runter zur Mutti gingen, spottete ich: „Was für arme Würstchen. Die werden nie über den Tellerrand schauen und haben für immer ihre Alten an der Backe.“
Ich heiratete einen Berliner, entdeckte das Schreiben und tauchte in die Medienwelt ein. Meine Mutter und meine Geschwister sah ich nur noch zu den großen Festen. Die fünfstündige Fahrt nach Hause nervte mich, meistens musste ich davor oder danach an meinen Texten arbeiten.
Meine Familie kannte mich hauptsächlich gestresst am Handy oder Laptop. Meistens blieb ich nicht lange, denn zuhause fühlte ich mich inzwischen im Prenzlauer Berg. Weihnachten verbrachte ich irgendwann lieber auf Bali, statt nach Hause zu fahren. Es gab zu viele Dinge, die mir wichtiger waren.
Meine erste Ehe zerbrach nach zwölf Jahren. Ich bekam ein Kind von einem neuen Mann, zog mit ihm raus aus der Stadt aufs Land. Dann kam Corona. Meine Mutter gehört in ihrem Alter automatisch zur Risikogruppe. Mein Schwager machte seine erste Chemotherapie. Keiner konnte sich sehen.
„Als Besuche plötzlich nicht mehr planbar waren, führte mir die Pandemie vor Augen, dass ich das Leben meiner Familie verpasse.“ -
Aber nicht erst seit Corona. „Warum brauchte ich einen Anlass, um meine Familie zu sehen?“, fragte ich mich, selbst fassungslos über mein jahrelanges Verschieben und Absagen von Besuchen. Meine Mutter sah ich nach sechs Monaten das erste Mal wieder. Sie war viel allein gewesen, wie so viele andere ältere und alleinstehende Menschen. Mir fiel auf, wie ihr Körper fragiler und ihre Bewegungen langsamer geworden waren. Ich bekam Panik. Wenn ihr etwas passiert, bin ich erst Stunden später da, um ihr zu helfen. Ich übte mehr denn je das Autofahren, damit ich reagieren kann, wenn es darauf ankommt.
Über meine Klassenkamerad*innen oder Frauen wie Hjördis Pflughaupt, die sich mit ihren Familien zusammen ein Haus kaufen, dachte ich nun ganz anders. Von wegen arme Würstchen, clevere Hasen sind das! Als hätten sie es gewusst, dass es irgendwann die richtige Entscheidung sein wird, die Familie nah bei sich zu haben.
Dann kam dieser Anruf.
Meine Schwester und ihr Mann teilten mir mit, dass sein Krebs zurück sei. Ich hörte, wie sie am anderen Ende der Leitung zerbrach. „Sei einfach meine Schwester“, antwortete sie, als ich fragte, wie ich ihr helfen kann. Ich wollte sie so dringend in den Arm nehmen und ihr zeigen, dass ich mich angesichts dieser Tragödie nicht ducke, sondern die ganze Scheiße mit auf meine Schultern lade. Aber ich war nicht da. Ich legte auf und heulte eine Stunde. Da spürte ich: Es geht nicht mehr anders. Ich musste nach Hause, und zwar nicht nur für ein Wochenende. Wir stornierten unseren Urlaub in Frankreich und verbrachten die kompletten Herbstferien in Köln-Dellbrück in einem Hotel in der Nähe der S-Bahn statt am Meer.

Das war okay. Ich fühlte mich wie eine Erbse, die zurück in ihre Schote rollt, genau an den Platz, der für sie gedacht ist. Meine Schwester und ich führten plötzlich wieder ein gemeinsames Leben. Das Band zwischen uns wurde stärker, indem wir uns im Alltag begegneten und uns nicht nur an einer schön gedeckten Festtafel mit Kaffee und Kuchen den Hintern platt saßen.
„Wir waren uns so nah, dass wir zeitgleich unsere Periode bekamen.“ -
Das war schon früher so, als wir noch unter einem Dach lebten.
Das Phänomen der menstruellen Synchronisation wird seit den Siebzigerjahren erforscht, bleibt aber umstritten. Die angebliche Ursache für die Angleichung des Zyklus von Frauen, die zusammen leben, arbeiten oder eng befreundet sind, sollen Pheromone sein. Diese Boten- und Lockstoffe werden über den Achselschweiß abgesondert, bewegen sich über die Luft zu unseren engsten Vertrauten und dienen der unterbewussten Kommunikation. Dabei soll es einen Alpha-Uterus geben, also eine Frau, deren Pheromone so stark sind, dass sie die Zyklen der anderen Frauen dominiert. Natürlich sagte meine Schwester, das sei ich.
Die zeitgleiche Regelblutung ist bei diesem Phänomen aber gar nicht das Interessante, obwohl es natürlich von Vorteil sein kann, dass man während seines PMS eine Leidensgenossin hat, mit der man sich zusammen mies fühlen kann. Forscher*innen haben für die Synchronisation der Fruchtbarkeit eine evolutionäre Erklärung: Dahinter steht der Plan der Natur, die Frauen gemeinsam fruchtbar werden zu lassen, damit sie gemeinsam ihre Kinder großziehen können.
Und so saßen meine Schwester und ich mit unseren Familien am Tisch, fütterten oder trösteten unsere Kinder, erzählten und lachten.

Der Tag der Abreise kam. Als ich meine Schwester zum Abschied lange im Arm hielt und sie sich an mich drückte, da merkte ich es so deutlich wie einen piksenden Stein im Schuh: Sie fehlt mir. Wir trauerten um unsere Trennung, die ich mit 18 als Befreiung empfunden hatte. Am liebsten wäre ich bei ihr geblieben oder hätte sie mitgenommen, damit wir jeden Tag in der Küche einen Kaffee zusammen trinken, unsere Kinder hüten oder einfach zusammen abhängen können.
Zurück in Brandenburg saß ich in meinem Homeoffice und dachte: „Wie gerne würde ich jetzt zum Mittagessen zu meiner Mutti fahren.“ Ein Mehrgenerationenhaus, in dem mindestens zwei Generationen unter einem Dach leben, schien mir die genialste Erfindung der Welt. So könnte meine Mutter ein Teil des Lebens meiner Tochter sein und nicht nur die Oma, die weit weg wohnt und ihrer Enkelin bei jedem Treffen anfangs fremd ist. „Ich bin so eine Idiotin“, dachte ich. Wieso musste ich damals bloß weggehen?
Als ich meine Gedanken dazu in meinen Storys auf Instagram teilte, ahnte ich nicht, wie viele Nachrichten ich von anderen Frauen bekommen würde, die den Zwiespalt zwischen Familie und Fernweh kennen und wissen, wie schwer es ist, zwischen zwei Orten hin- und hergerissen zu sein. Es gibt viele, die beruflich gar keine andere Wahl haben, als anderswo zu wohnen. Andere haben sich so wie ich damals verliebt und sind in der Ferne geblieben. Eine Frau schrieb mir:
„„Man ahnt mit Mitte zwanzig nicht, wie sich die Prioritäten später verschieben.““ -
Wie wahr, denn wann war ich bitte das letzte Mal in einem Club, in dem es bumste?
Eine andere Leserin traf deshalb sogar eine radikale Entscheidung: „Vor drei Jahren habe ich von heute auf morgen die Zelte in Berlin abgebrochen und bin zurück in die Kleinstadt. Es war hart und hat fast meine Ehe gekostet. Drei Jahre später bin ich froh, wieder so nah bei der Familie zu sein.“
Tatsächlich gibt es eine Studie der Jacobs University in Bremen, die bestätigt: Wer sich der Heimat verbunden fühlt, ist glücklicher. Wen wundert es also, dass wir uns in Krisenzeiten wieder in Richtung Ursprung orientieren. Als ich mich von meinem ersten Mann trennte, verbrachte ich vier Wochen bei meiner Mutter und schlief in meinem Kinderzimmer, in der gleichen Bettwäsche wie zu Schulzeiten. Nur so konnte ich den Faden meiner Geschichte wieder aufnehmen und weiterspinnen, nachdem ich ihn komplett verloren hatte.
„Zurück zu den Wurzeln“ ist demnach keine abgelutschte Redewendung, sondern eine Überlebensstrategie, die dann greift, wenn wir uns orientierungslos oder entfremdet fühlen. Spätestens im Lockdown dürften viele von uns Bekanntschaft mit diesem Gefühl gemacht haben: Die Menschen sind ohne die Kultur, Restaurants, Cafés, Läden, das Leben auf der Straße und den Austausch mit Nachbar*innen, Freund*innen oder Kolleg*innen nicht mehr sie selbst. Die Sehnsucht nach einer vertrauten Einfachheit wächst, weil da ständig etwas ist, auf das wir uns neu einstellen müssen.

Die Studie der Jacobs University bestätigt übrigens auch, dass das Heimatgefühl mit dem Alter wächst. Aber so groß die Sehnsucht nach dem Rheinland und der Herzlichkeit der Menschen dort auch sein mag: Ich werde nicht zurückziehen. „Heimat ist da, wo dein Herz ist“ – und das ist eben da, wo meine eigene kleine Familie lebt. Trotzdem bauen wir jetzt unsere Scheune in Brandenburg um, inklusive mehrerer Schlafräume. Ihr ahnt es schon: Das Mehrgenerationenhaus – ich baue es mir einfach selbst.
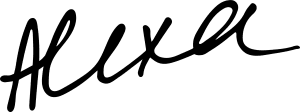
Die Audiodatei gibt es hier als Download.

Abo abschließen, um Artikel weiterzulesen
Endlich Ich - Abo
6,90€
Alle Artikel lesen, alle Podcasts hören
4 Wochen Laufzeit, monatlich kündbar
Digitaler Goodie-Bag mit exklusiven Rabatten
min. 2 Live-Kurse pro Woche (Pilates, Workouts, etc.)
Bereits Abonnent? Login