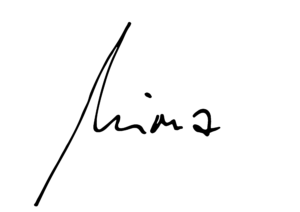Diesen Text gibt es auch als Audio-Artikel, zum Anhören und Downloaden einfach hier klicken.
Drei Jahre Rosenkrieg. Drei Jahre böse E-Mails, böse Anrufe und böse Treffen. Drei Jahre Anwälte, Beleidigungen, Streits. Drei Jahre Stress und nichts weiter als Stress. So sah das aus mit dem Vater meiner Tochter. Nachdem ich ihn sechs Monate nach der Geburt verlassen hatte, nutzten wir unsere neugewonnene Zeit nicht produktiv, sondern vor allem destruktiv. Jeder glaubte, recht zu haben und mehr verletzt als der andere sein zu dürfen.
Dabei hatte alles so schön begonnen in diesem Sommer 2014 in Tel Aviv. Ich schrieb an meinem Roman und an einer Reportage über die israelische Kunstszene für das Interview Magazine. Immer, wenn ich mit einem Galeristen, einer Kuratorin oder einem Künstler sprach, tauchte sein Name auf. „Den musst du treffen“, „Mit dem brauchst du noch ein Interview“, „Der ist eine Institution!“ Das waren die Sätze, die mir alle entgegenwarfen. Also versuchte ich diesen Mann zu treffen, der viele Jahre als Kunstkritiker für israelische Zeitungen geschrieben hatte und jetzt Galerist war.

Wenige Tage später trafen wir uns zum Interview in einem kleinen Café auf der Washington Street, einer Fußgängerzone in Florentin, dem Kreuzberg von Tel Aviv. Über uns schoss das Raketenabwehrsystem „Iron Dome“ Raketen ab, die aus Gaza geflogen kamen. Immer wieder knallte es über unseren Köpfen. 15 Minuten, dachte ich, würde das Gespräch dauern. Mehr Zeit hatte ich dafür nicht eingeplant. Sieben Stunden später verließen wir das Café. Am nächsten Morgen rief ich eine Freundin an und sagte: „Ich will ein Kind von diesem Mann.“ Und so kam es.
„Wir verliebten uns blind und stürmisch und komplett besinnungslos.“ -
Ich zog zwei Monate später mit Sack und Pack nach Tel Aviv und war weitere vier Monate später schwanger. Dann begannen wir schon die Hochzeit zu planen. Wir sprachen von großer Liebe. Der größten überhaupt. Einer Liebe, die natürlich niemals enden würde, für die wir geboren worden waren, die zu jenen Lieben gehörte, die voller Wahrhaftigkeit steckten. Nicht, dass es keine Probleme gab. Die gab es eigentlich von Anfang an. Aber wir taten sie als Nebenwirkung unserer so unglaublichen Liebe ab.
Als dann unsere Tochter in Berlin geboren wurde, gab es keine Zeit mehr dafür, uns gegenseitig die rosarote Brille aufzusetzen und Liebesschwüre zu säuseln. Es ging ums Windelnwechseln, Geldverdienen, Füttern und So-viel-Schlaf-wie-möglich-Bekommen. Für einen pragmatischen Alltag war unsere Liebe wirklich nicht gemacht worden. Daran gab es keinen Zweifel. Also trennte ich mich. In diesen drei Jahren des Rosenkriegs, der selbstverständlich so leidenschaftlich war wie die Liebe davor, schickte ich immer wieder Nachrichten. Keine Ich-will-dich-zurück-Nachrichten, sondern Die-Tür-steht-immer-offen-Nachrichten.
Wir-müssen-uns-nicht-für-immer-hassen-Nachrichten. Wir-haben-doch-ein-Kind-Nachrichten. Als ich im September letzten Jahres wieder in Tel Aviv war, ohne unsere Tochter, um an meinem neuen Roman zu schreiben, schickte ich erneut eine Die-Tür-steht-offen-lass-Kaffee-trinken-Nachricht und diesmal bekam ich eine Antwort. Es war ein bisschen wie bei unserer ersten Begegnung. Aus einem kurzen Treffen wurden Stunden. Da war es, das, was uns verbunden hatte, weswegen wir uns verliebt hatten, war immer noch da: unsere Liebe zum Dialog. Ja, wir hatten sie auf dem Weg zum Schlachtfeld ein bisschen verloren, aber wir hatten sie offensichtlich nicht töten können. Das fühlte sich gut und richtig an. Endlich wusste ich wieder, warum ich diesen Mann als Vater meiner Tochter ausgewählt hatte. Endlich verstand er, warum er sich damals vor fünf Jahren in mich verliebt hatte. Hinter dem Staub, den wir aufgewirbelt hatten, konnten wir uns jahrelang nur noch als Silhouetten wahrnehmen.
„Jetzt waren wir wieder zu dreidimensionalen Menschen geworden.“ -
Die Wochen nach diesem Treffen telefonierten wir viel, dann stritten wir uns, dann schwiegen wir wieder, dann sprachen wir erneut, mochten uns mehr, stritten über die Vergangenheit, waren enttäuscht voneinander, vertrugen uns, trafen uns, stritten uns, mochten uns, waren enttäuscht.
Seit neun Monaten geht das nun so und ich, aber auch er, arbeiten hart daran, dass wir die Grenzen des anderen, die Vorstellungen und die Erwartungen einfach anerkennen. Manchmal kommen wir ins Träumen, stellen uns vor, wie wir die letzten 20 Jahre unseres Lebens miteinander verbringen, dann nämlich, wenn es keinen pragmatischen Alltag mehr braucht, sondern nur noch ein Baumhaus. Und drei Anrufe später erinnert mich dieser Mann mit nur einem einzigen Satz daran, warum ich ihn verlassen habe: aus den richtigen Gründen nämlich.

Unsere Tochter bekommt von unseren Versuchen, gute Freunde füreinander zu werden, nichts mit. Sie hat endlich einen Vater, der fast täglich anruft, der sie sieht, der sie spiegelt. Wenn sie dann im Bett liegt, hänge ich am Telefon mit ihm und er mit mir, und wir versuchen Sinn aus dieser Begegnung zu machen. Das gelingt uns eben an manchen Tagen besser und an anderen schlechter. Aber mit jedem Anruf, mit jedem Versuch, fühle ich mich freier. Eine lange Zeit dachte ich, dass ich einen Fehler gemacht hätte. Eine völlig falsche Entscheidung traf, als ich ihn zum Vater meines Kindes machte. Das nagte an mir. Als Frau, nicht als Mutter.
„Ich weiß heute, dass alles richtig so war. Die große Liebe, die wir füreinander empfanden. Der Rosenkrieg, der darauf folgte.“ -
Alles genau so, wie es sein sollte, auch wenn es Nerven und Geld gekostet hat. Auch wenn es immer noch Nerven kostet und auch weiter kosten wird. Das ist der Deal, den zwei Menschen miteinander eingehen. Insbesondere, wenn sie Eltern werden.
Portrait: Shai Levy