Diese Website benutzt technische Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.
Finanzen & Sparen
Hereinspaziert in mein Haushaltsbuch
Lotte kämpft um ihr Café im Lockdown, Rentnerin Helga ist froh über ihren Immobilienkauf. Zwei Geschichten.
von Lena Schindler - 01.04.2021

Was sind uns unsere Träume wert? Diese Frage spielt im Leben der beiden Frauen, die wir euch dieses Mal vorstellen möchten, eine große Rolle. Die eine verzichtet für ihr kleines Café auf finanzielle Sicherheit und spürt gerade in Coronazeiten, wie sehr es sich um das zu kämpfen lohnt, was sie sich in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat. Die andere hat ihr Berufsleben schon hinter sich – und sagt angesichts all der aktuellen Beschneidungen in unserem Leben: „Gut, dass ich immer in meine Freiheit investiert habe!“
Wir sagen Danke für diese Einblicke und würden uns riesig freuen, wenn noch mehr von euch bereit wären, mit uns über ihre Finanzen zu sprechen. Ihr führt gar kein Haushaltsbuch? Umso besser! Dann bietet sich hier die großartige Gelegenheit, sich endlich mal einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu verschaffen – und vielleicht am Schluss die ewige Frage zu klären: Warum ist am Ende des Geldes eigentlich immer so viel Monat übrig? Freiwillige vor! Schreibt uns an dasabo@ohhhmhhh.de.
Los geht’s!

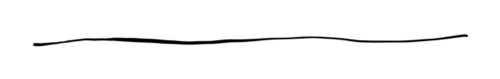
Lotte (36) führt ein eigenes Café in Augsburg und hofft, dass sie ihr Gastro-Baby gut durch die Krise bringt.
Einnahmen:
Gewinn: 1.500 Euro
Ausgaben:
Miete: 550 Euro
Nebenkosten: 80 Euro
Private Krankenversicherung: 300 Euro
Private Altersvorsorge: 150 Euro
Haftpflichtversicherung: 4 Euro
Lebensmittel: 100 Euro
Drogerie: 25 Euro
Kosmetik, Friseur: 20 Euro
Handy, Internet: 30 Euro
Essen gehen/bestellen: 40 Euro
Klamotten: 50 Euro
Yoga: 50 Euro
Wer so einen kleinen Laden betreibt wie ich, der kann es nur aus Leidenschaft tun. Es war immer mein Traum, ein Café aufzumachen, und in den Zeiten, in dem es durch die Pandemie komplett schließen musste, ist mir bewusst geworden, wie sehr ich eigentlich den Umgang mit den Gäst*innen liebe und wie er mir fehlt, wenn wir keine Menschen bei uns empfangen und bewirten dürfen. Man muss wirklich darin aufgehen und es aus Freude tun, denn eine Goldgrube ist es nicht – jedenfalls unseres nicht. Ich führe das Café seit zwölf Jahren gemeinsam mit einer Freundin, was von Anfang an sehr gut funktioniert hat. Wir sind ein kleines Tagescafé mit 30 Sitzplätzen und leben vom Frühstücksgeschäft und vom Mittagstisch. Wir können beide davon leben, aber reich wird man eben nicht davon. Wir beschäftigen vier Festangestellte in Teilzeit und fünf Aushilfen auf 450-Euro-Basis. Meine Freundin und ich machen beide auch im Service mit. Sie arbeitet Vollzeit, ich im Moment in Teilzeit mit 25 Stunden, da ich nach einigen extrem stressigen Jahren mit dem Café, einem kranken Elternteil und einigen anderen privaten Baustellen mal ein bisschen kürzertreten und Zeit zum Durchatmen haben wollte.

Vor der Pandemie hatten wir es so geregelt, dass meine Freundin 2.500 Euro monatlich ausbezahlt bekam, ich 1.500 Euro, das läuft bei einer GbR, also einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, als Privatentnahme. Von dem Gewinn, der am Jahresende ausgeschüttet wird, bekommt sie auch entsprechend mehr, weil sie eben mehr arbeitet. Bisher ist das Geld, was übrig war, aber immer im Unternehmen geblieben, ging also auf unsere Kapitalkonten – jede von uns beiden Gesellschafterinnen hat ihr eigenes, es stellt den jeweiligen Anteil am Vermögenswert des Ladens dar. Wir machen im Schnitt 350.000 Euro Jahresumsatz, was erst mal ganz schön viel klingt. Davon bleiben als Überschuss aber nicht mehr als 60.000 Euro übrig, die zwischen uns aufgeteilt werden bzw. in Anschaffungen und Renovierungen investiert werden. Dass der Gewinn so niedrig ist, liegt daran, dass wir hohe Wareneinsätze haben, denn wir kaufen nur sehr hochwertige, regionale Zutaten ein. Außerdem sind die Löhne ein riesiger Kostenblock, dadurch gehen schon mal fast 50 Prozent vom Umsatz weg.
Insgesamt springt also kein besonders hohes Jahreseinkommen für uns raus. Denn als Selbstständige muss man von seinem Gehalt ja auch noch seine soziale Absicherung bezahlen, allein die Krankenkasse kostet mich 300 Euro im Monat. Eigentlich müsste ich natürlich ordentlich für meine Rente vorsorgen, was ich bisher aber nur mit einem Betrag von 150 Euro tue, aber es lässt sich aktuell gar nicht anders machen. Denn die gut 1.000 Euro, die mir netto übrig bleiben, brauche ich, um meine Fixkosten zu bezahlen.
„Unser Café läuft seit Beginn gut und ist meistens voll, trotzdem haben wir in all den Jahren keine großen Gehaltssteigerungen gehabt.“ -
Als Corona kam, haben wir uns als Inhaberinnen erst mal weiterhin unsere Gehälter gezahlt, denn während des ersten Lockdowns waren wir noch einigermaßen liquide. Außerdem kam zügig die Soforthilfe von 15.000 Euro – für die zweieinhalb Monate, die komplett geschlossen waren. Und das Kurzarbeitergeld für die Angestellten wurde von der Arbeitsagentur gezahlt. Somit konnten wir die laufenden Kosten, wie etwa die 2.000 Euro Ladenmiete, mit den staatlichen Hilfen decken und sind gut durch diese Zeit gekommen. Wir hatten auch großes Glück, dass wir den ganzen Sommer über gut zu tun hatten und auch im Herbst ordentlich ranklotzen konnten. Aber der Umsatzausfall lässt sich natürlich nicht wieder reinholen.
Die Hilfe für November und Dezember kam leider zögerlich und wurde erst vollständig im Februar gezahlt. Das waren 75 Prozent vom Vorjahresumsatz des Vergleichsmonats, also einmal 12.000 Euro, einmal 10.000 Euro, denn ausgerechnet diese beiden sind immer unsere schwächsten Monate. Dadurch, dass die Zahlungen so spät kamen, wurde es auch für uns zum Jahresende ziemlich eng, denn die Löhne müssen ja erst mal vorgestreckt werden, bevor sie von der Arbeitsagentur erstattet werden. So hohe Kosten, keinerlei Einkünfte – das hat uns schon schlaflose Nächte gekostet. Als die Hilfe dann kam, war das wirklich ein Segen. Für die Zeit von Januar bis März werden wir eine Überbrückungshilfe für die Fixkosten beantragen, da der Laden die meiste Zeit zu war.

Wir haben nun das To-go-Geschäft wieder aufgenommen, um präsent zu bleiben und unsere Gäst*innen nicht zu verlieren. Und wir als Inhaberinnen müssen auch ein bisschen was verdienen, denn Unternehmerlohn kommt in keinem der Hilfsprogramme vor: Unsere Läden werden gerettet, aber unsere eigene Existenz nicht. Wir beide haben also seit Januar kein Gehalt mehr bekommen. Meine Eltern haben mir in dieser Zeit ein bisschen unter die Arme gegriffen – wofür ich sehr dankbar bin, was ich aber nur schwer annehmen konnte. Denn seit meinem Auszug vor 17 Jahren habe ich sie nie um Hilfe bitten müssen. Mit dem kleinen To-go-Angebot, das wir zu zweit stemmen können, werden nun für jede von uns monatlich 1.000 Euro rausspringen – immerhin. Dann komme ich auch wieder ohne den Eltern-Support klar.
Natürlich ist es auch für unsere Angestellten eine harte Zeit. Wenn man sowieso in Teilzeit arbeitet, davon dann nur die 61 Prozent Kurzarbeitergeld bekommt und das Trinkgeld wegfällt, dann stehen unsere Servicekräfte mit 600 Euro im Monat da. Davon zu leben, ist eigentlich nur machbar, wenn man jemanden im Rücken hat, der einen unterstützt. Zum Glück fallen unsere Leute vergleichsweise weich, weil entweder der*die Partner*in besser verdient oder sie noch studieren und bei den Eltern wohnen.
„Ich war schon immer ein sparsamer Mensch und bin in diesen Zeiten froh, dass ich keine besonders hohen Fixkosten habe.“ -
Ich lebe in einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung zur Miete und habe – abgesehen von den Wohnkosten – keine großen Ausgaben. Ich besitze kein Auto, ich gebe nicht viel Geld für Klamotten oder andere materielle Dinge aus. Da ich keine Kinder habe und nur für mich selbst verantwortlich bin, kann ich mit der Ungewissheit einigermaßen leben. Aber ich fürchte natürlich um das, was wir uns mit so viel Mühe aufgebaut haben, unser Café – und damit unsere Existenz. Denn wenn wir es am Ende aus der Not verkaufen müssten, dann wären wir auch nicht in der Position, für uns den besten Preis rauszuholen. Ganz davon abgesehen, dass unser Herz daran hängt – und Aufgeben eigentlich gar nicht infrage kommt.
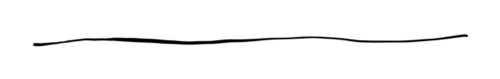
Helga (73) ist pensionierte Ärztin aus Berlin und hat sich in ihrem Leben für mehr Selbstbestimmung und gegen großen Besitz entschieden.
Einnahmen:
Ärzteversorgung/Rente: 2.230 Euro
Ausgaben:
Kredit: 416 Euro
Verwaltung/Hausgeld: 269 Euro
Nebenkosten: 120 Euro
Private Krankenversicherung: 813 Euro
Zusatzkrankenversicherung/Krankenhausschutz: 9 Euro
Handy/Internet: 49 Euro
Rechtsschutzversicherung: 30 Euro
Lebensmittel-Lieferservice: 120 Euro
Reformhaus/Gemüseladen: 50 Euro
Apotheke: 100 Euro
Kinderpatenschaft: 39 Euro
Friseur: 25 Euro
Wer einen Doktortitel hat, der muss auch wohlhabend sein! Den Gedanken haben viele – obwohl das eine mit dem anderen nicht zwingend etwas zu tun haben muss. Ich jedenfalls kann nicht behaupten, dass ich in Saus und Braus lebe, obwohl ich Medizin studiert und auch lange als Allgemeinmedizinerin gearbeitet habe – anfangs in einem Krankenhaus, später hatte ich auch phasenweise eine kleine Praxis. In dieser Zeit habe ich sehr gut verdient. Meinen Beruf habe ich immer mit Leidenschaft ausgeübt, aber ihn auch oft als sehr belastend empfunden. Ich konnte mich schlecht von meinen Patient*innen, ihren Sorgen und Nöten abgrenzen und machte dauernd Hausbesuche, war rund um die Uhr erreichbar, obwohl mich das oft an meine Grenzen brachte. Darum gab es in meinem Leben immer wieder Zeiten, in denen ich lange auf Reisen gegangen bin, um Abstand zu finden, zur Ruhe zu kommen – aber auch, weil ich das freie Leben immer geliebt habe. Ich war zehn Monate auf La Palma, mal ein halbes Jahr auf Sri Lanka, ein Jahr in Norwegen … Selbstfindung nennt man das wohl heute. Ein Mittelmaß habe ich nie wirklich gut hinbekommen, entweder arbeitete ich wie eine Verrückte – oder gar nicht.
„Es gab also immer wieder Zeiten mit gutem Verdienst, aber auch welche ohne. “ -
In den letzten Jahren meines Berufslebens hat es sich erst so eingependelt, wie es mir eigentlich gutgetan hätte: Ich war nur noch einzelne Tage in einer Gemeinschaftspraxis tätig. Vor acht Jahren habe ich ganz aufgehört. Seit ich nicht mehr arbeite, bekomme ich von der Ärzteversorgung eine monatliche Rente von 2.230 Euro. Davon könnte ich mir ein richtig schönes Leben machen – wäre da nicht die private Krankenversicherung, die einen großen Teil davon verschlingt. Die exponentiellen Beitragssteigerungen kommen dabei erst ziemlich spät, nach der letzten Erhöhung sind es tatsächlich 813 Euro im Monat. Früher habe ich mir um das Thema zu wenig Gedanken gemacht, heute würde ich mich um einen Versicherungsvertrag bemühen, der die Beiträge deckelt, daran habe ich damals nicht gedacht. Ab einem Alter von 55 Jahren kommt man da dann nicht mehr raus. Auch wenn man angestellt ist, lässt sich nicht mehr in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln – jedenfalls bei mir hat es nicht funktioniert.
Gerade denke ich darüber nach, in den Basistarif zu wechseln, wodurch ich etwa 200 Euro sparen könnte. Aber das ist natürlich in meinem Alter etwas, das man sorgfältig abwägen muss. Nicht mehr alle Leistungen werden dann übernommen und mit den Jahren wird man ja auch nicht unbedingt fitter und gesünder. Bevor ich den Luxustarif aufgebe, würde ich in jedem Fall noch mal alle Untersuchungen machen lassen, die sinnvoll sind und in der günstigeren Variante nicht mehr abgedeckt werden. Neben dem hohen Beitrag ist so eine private Versicherung oft gar nicht so erstrebenswert, wie viele glauben, weil vieles nicht direkt abgerechnet wird, sondern vom Patienten bzw. der Patientin vorgestreckt werden muss. Da ist man allein in der Apotheke schnell mal ein paar Hunderter los, die dann erst wieder erstattet werden müssen. Außerdem wurden die Privatpatient*innen in Berlin gerade bei den COVID-19-Impfungen vergessen. Das ist natürlich auch nicht so toll – gerade, wenn man zur Risikogruppe zählt.

Da ich mir vor zehn Jahren eine Eigentumswohnung in Berlin gekauft habe, in der ich selbst lebe, habe ich keine Mietkosten, zahle lediglich das Hausgeld von monatlichen 269 Euro an die Verwaltung sowie 120 Euro Nebenkosten. Die Wohnung habe ich damals von privat gekauft und von meinen Ersparnissen komplett bezahlen können. Zu dem Zeitpunkt waren die Kaufpreise noch günstig und ich habe nur 120.000 Euro dafür bezahlt – was mir damals sehr viel vorkam für zweieinhalb Zimmer. Nun freue ich mich, dass der Wert so enorm gestiegen ist! Ich hatte oft ein schlechtes Gewissen, dass ich aufgrund meines unsteten Lebens meinen beiden Töchtern später mal nicht groß etwas würde vererben können. Aber nun sieht es so aus, als habe sich die Wohnung im Wert fast verdreifacht. Jedoch muss ich gestehen, dass ich wirklich nur großes Glück hatte: Der Tipp kam damals von meinem Schwager, ich habe mir nur diese eine Wohnung angesehen – und zugeschlagen, ohne auf eine große Wertsteigerung zu spekulieren. Aber so kann es ja auch mal laufen im Leben. Von diesem Glücksgriff abgesehen, habe ich leider kein Händchen für finanzielle Dinge.
„Sonst habe ich mir durch mein Erspartes immer die Zeiten in meinem Leben finanziert, in denen ich nicht gearbeitet habe.“ -
Da der Vater meiner Kinder, von dem ich schon lange getrennt lebe, weniger verdiente als ich, habe ich der einen Tochter das Studium finanziert und der anderen während der Ausbildung unter die Arme gegriffen. Über große Ersparnisse verfüge ich nicht, aber ich habe eine eiserne Reserve von 20.000 Euro auf einem Sparbuch, die sollen aber da nach Möglichkeit auch bleiben. Denn es beruhigt mich zu wissen, dass ich im äußersten Notfall darauf zurückgreifen könnte.
Um meine Wohnung sanieren zu lassen, habe ich vor acht Jahren einen Kredit von 40.000 Euro aufgenommen und dafür wirklich alles machen lassen, was man sich vorstellen kann: von neuen Fenstern über moderne Heizkörper bis hin zu einer begehbaren Dusche. Dafür zahle ich noch zwei Jahre lang monatlich 416 Euro ab. Bis dahin bleibt mir nicht allzu viel Spielraum, aber ich habe auch keine großen Ausgaben und nicht das Gefühl, mich einschränken zu müssen. Nach Abzug der Fixkosten plus dem, was ich für Lebensmittel und Medikamente ausgebe, bleiben mir gut 250 Euro, die ich normalerweise für Kino, Theater, Museumsbesuche und Essengehen ausgebe – oder dafür, meine Töchter und Enkelkinder zu besuchen, aber dazu habe ich im Moment natürlich wenig Gelegenheit.

Wichtig war mir immer, Mädchen in Entwicklungsländern durch eine Patenschaft zu unterstützen, denn sie sind besonders von Armut und Ausbeutung betroffen. Das mache ich schon ewig. Aktuell unterstütze ich ein Mädchen aus Haiti, damit sie zur Schule gehen und eine Chance auf ein besseres Leben hat, im Monat zahle ich 39 Euro an mein Patenkind.
Da ich allein lebe, habe ich das vergangene Jahr als sehr isolierend empfunden. Meine Töchter möchten auch nicht, dass ich dauernd in den Läden herumlaufe, daher bestelle ich den Großteil meiner Lebensmittel über den Lieferservice eines Supermarktes, was super funktioniert. Aber dadurch fallen natürlich auch die täglichen Erledigungen weg. Ich gehe stattdessen viel mit Freundinnen spazieren – und ich freue mich umso mehr über die Zeiten in meinem Leben, in denen ich so viel von der Welt sehen konnte. Wenn ich heute daran denke, stimmt mich der Gedanke, dass ich mein Leben so gestalten konnte, sehr versöhnlich.

Abo abschließen, um Artikel weiterzulesen
Endlich Ich - Abo
6,90€
Alle Artikel lesen, alle Podcasts hören
4 Wochen Laufzeit, monatlich kündbar
Digitaler Goodie-Bag mit exklusiven Rabatten
min. 2 Live-Kurse pro Woche (Pilates, Workouts, etc.)
Bereits Abonnent? Login