Diese Website benutzt technische Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.
Gefühle & Gedanken
Doch noch ein gutes Jahr
Das Jahr 2020 ist herausfordernd für alle. Aber es gibt auch Geschichten, die Mut machen.
von Lena Schindler - 01.12.2020

Ganz klar, 2020 war für alle eine echte Packung. Für jeden auf seine Art. Manche hat die Epidemie ein bisschen ins Wackeln gebracht, andere komplett umgehauen. Und trotzdem: Wie jede Krise hat auch diese nicht nur Schattenseiten. Fünf Mutmachgeschichten.

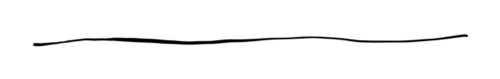
Marco und Patrick Gaffrey, 32 und 29, gaben sich während des Lockdowns das Jawort. Und wurden trotz Abstandsregeln mit ganz viel Nähe belohnt.

Als sich Ende März abzeichnete, dass eine große Hochzeitsfeier mit vielen Gästen wohl erst mal nicht würde stattfinden können, fühlte es sich im ersten Moment an wie ein Drama. Wir hatten diesen Tag im Mai mit so viel Liebe für die Menschen, die uns am Herzen liegen, geplant, uns gefreut, mit ihnen zusammen unsere Hochzeit zu feiern. Doch als alles anders als geplant wurde, bekamen wir viel Rückhalt von unseren Familien und unseren Freunden, die uns vermittelten: Am Ende geht es nur um euch zwei und darum, dass ihr „Ja“ zueinander sagt, alles andere können wir nachholen! Also haben wir die große Party auf 2021 verschoben.
Es mag trotzig klingen, aber wir wollten es uns dennoch nicht nehmen lassen, noch in diesem Jahr zu heiraten. Da wir an einem 13. unsere erste Verabredung hatten, war es uns wichtig, dass die Trauung auch am 13. eines Monats stattfinden würde, am liebsten im Mai. Diesen Termin hatten wir und wollten ihn auch nicht verfallen lassen. Darum haben wir gesagt: Wir machen das jetzt – ganz egal, wie der Tag aussehen wird. Und obwohl wir nicht mal wussten, wen wir überhaupt ins Standesamt mitnehmen dürfen. Aber dass unsere Familien nicht dabei sein würden, stand leider ohnehin fest: Denn sie wohnen teilweise sehr weit weg oder gehören zur Risikogruppe. Eine Woche vor dem Termin kam dann die Nachricht, dass wir immerhin vier Leute mit ins Standesamt in Jork in der Nähe von Hamburg nehmen können, wir mit bis zu zehn Personen draußen anstoßen dürfen. Als wir nach der Trauung rauskamen, waren vier Freunde als Überraschung gekommen, zwei sogar extra aus Berlin – nur um uns einmal einen Luftkuss zuzuwerfen!
Danach sind wir zu einer Freundin im Alten Land gefahren, die mit einem Obstbauern zusammenlebt, und haben zwischen den Apfelbäumen unsere Hochzeitsfotos aufgenommen. Die Schlüssel für unsere Hamburger Wohnung hatten wir unseren Trauzeugen gegeben und als wir dort ankamen, war alles mit Wolken aus Schleierkraut dekoriert. Unter unserem Balkon im ersten Stock stand ein dekorierter Hochtisch, an dem zwei Freundinnen von uns warteten, um uns zu gratulieren. Das kam für uns völlig unerwartet und wir haben uns wahnsinnig gefreut. Wir hatten ein kleines Körbchen, in dem wir Getränke und Snacks herunterlassen konnten, haben ihnen vom Balkon aus zugeprostet. Als die beiden gingen, dachten wir, jetzt können wir mit den Trauzeugen und deren Partnern etwas essen, aber dazu gab es keine Gelegenheit – bis zum späten Abend nicht. Denn im Halbstundentakt kamen nun immer zwei Leute an den Tisch und wir waren jedes Mal wieder überrascht, wer da alles antanzte. Besonders schön war, dass wir die ganze Zeit nebeneinanderstanden. Bei einer normalen Feier tingelt man durch den Raum und ist damit beschäftigt, mit allen zu reden, aber wir konnten uns intensiv mit jedem austauschen. Eine Freundin ist sogar ganz aus Nürnberg gekommen, nur um eine halbe Stunde unter unserem Balkon zu stehen.
„Ein ganz besonderer Moment war auch das Konzert einer Freundin auf dem Bürgersteig.“ -
Sie hat den Song „Dog Years“ von Maggie Rogers gesungen, der unser erster Tanz hätte sein sollen. Es war fast dunkel, sie wurde auf der Ukulele begleitet, andere haben Schilder mit dem Text hochgehalten und die Nachbarn traten auf ihre Balkone. Diesen Moment mit so vielen Menschen zu teilen, war wunderschön.
Am Ende war es so, dass wir uns nur zwischendrin mal etwas von unserer Brotzeitplatte reingepfiffen haben und sonst gar nicht zum Essen kamen. Und weil wir mit jedem anstoßen wollten, hatten wir spät am Abend richtig einen sitzen, waren total platt von dem Sekt und den Emotionen.
Was wir daraus mitnehmen, ist, wie wundervoll es ist, wenn Menschen sich Zeit für einen nehmen. Auch wenn wir diesen Tag so positiv und enthusiastisch beleuchten, wie wir es tun, schwingt natürlich auch Wehmut mit, weil wir unsere Familien bei der Trauung nicht dabeihaben konnten. Aber es ist eben so viel Wundervolles passiert, dass das Glücksgefühl überwiegt. Trotz der Distanz haben wir ganz viel Nähe und Anteilnahme gespürt, das war ein großes Geschenk und sehr bewegend. Vielleicht wäre auch unsere Einstellung gegenüber 2020 eine andere, hätten wir die Feier abgesagt. Dass dieser Tag so besonders war, hat das Mindset für das ganze Jahr positiv beeinflusst. Denn wir haben gelernt: Egal wie schlimm es gerade ist, es gibt immer auch etwas wirklich Schönes.
Für Kathrin Willhöft, 38, gab Corona den Anstoß, der Großstadt den Rücken zu kehren. Sie hat nun ihre kleine Freiheit im Grünen gefunden.

Als ich im Freundeskreis verkündete, dass wir rausziehen, kam fast jedes Mal der Spruch: „Du bist die Letzte, von der ich das erwartet hätte.“ Wahrscheinlich, weil ich die letzten zehn Jahre von einer Großstadt in die nächste gezogen bin: von München nach Berlin, dann nach Hamburg, nach New York, zurück nach Hamburg und wieder nach München. Ich war in der Stadt zuhause und habe das Leben dort in vollen Zügen genossen. Als ich vor zweieinhalb Jahren das erste Mal Mama geworden bin, fand ich es schön, mitten in Schwabing zu leben, durch die Läden zu bummeln, mich mit anderen Müttern auf dem Spielplatz zu treffen oder ins Café zu gehen.
Je größer der Kleine wurde, desto mehr änderten sich seine Bedürfnisse und auch meine Prioritäten. Und ich stellte zum ersten Mal fest:
„Okay, die Stadt hat leider nicht nur Vorteile.“ -
Mich hat es auf einmal gestört, dass wir so dicht an der Hauptstraße wohnten und ich ihn jedes Mal vorm Verkehr abschirmen musste, wenn wir aus der Haustür kamen. Mein Sohn ist ein sehr aktives Kind, es war immer eine echte Kamikaze-Aktion, ihn heil zum Spielplatz zu lotsen, wenn er mit dem Roller losraste.
Ich glaube, dass der Wunsch, ins Grüne zu ziehen, sowieso latent in uns schlummerte, aber Corona wirkte wie ein Beschleuniger und hat uns den letzten Schubs gegeben, diesen Move zu machen. Während des Lockdowns hatten wir immer die Stadt vor Augen, aber sie war wie verschlossen. Das hatte etwas Gespenstisches. Und all das, was das Leben in der Stadt ausmacht, konnten wir nicht mehr nutzen. Das dauernde Abstandhalten zwischen vielen Menschen, der Versuch, bloß niemandem zu begegnen, das hat uns einfach schneller an den Punkt gebracht zu sagen: So, jetzt reicht es!
Wir waren uns erst gar nicht sicher, ob es überhaupt Immobilienangebote gibt und Besichtigungen stattfinden. Doch die gab es. Und tatsächlich haben wir beim ersten Objekt zugeschlagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht war es gut, dass wir ganz unbefangen und ohne Erwartungen an die Sache rangegangen sind. Weil ich die Stadt so gewohnt war, hat sich der Schritt sehr groß angefühlt, ehrlich gesagt, sogar beinahe so groß, wie damals nach New York zu gehen. Dabei sind wir nur eine knappe halbe Stunde aus München raus. So richtige Landbewohner würden wahrscheinlich über uns lachen, weil wir hier auch einen Ortskern mit Infrastruktur haben, aber für uns war es trotzdem so, als würden wir aufs Land ziehen.
Wir fühlen uns hier im Voralpenland wie in einem totalen Idyll. Wir haben eine Doppelhaushälfte gemietet, um ein Fleckchen Grün vor der Tür zu haben, das fühlt sich nochmal ganz anders an als ein Balkon, wie unsere eigene kleine Freiheit. Es muss gar nicht immer der riesige Garten sein, einfach ein Ort, an dem man mal in Ruhe einen Kaffee trinken kann – ohne ständig Angst haben zu müssen, dass das Kind unter die Räder kommt. Man ist nicht gleich in diesem Gewusel von Menschen, Autos und Fahrrädern, sobald man das Haus verlässt. Der Kleine lief hier im Sommer nur noch barfuß und dreckverschmiert durch die Gegend, hat sich richtig ausgetobt und ist abends ganz anders müde ins Bett gefallen. Er bekommt die Jahreszeiten intensiver mit, weil sie direkt vor der Haustür passieren. Und ich bin froh, dass unser zweites Kind, das gerade unterwegs ist, das auch bald erleben darf.
Für uns war die Entscheidung richtig, der Grundzustand ist bei uns allen entspannter geworden. Gut möglich, dass wir sie noch immer nicht getroffen hätten, wäre der Lockdown nicht so einschneidend gewesen. Wenn das Leben irgendwann wieder einen normaleren Gang geht, freuen wir uns aber auch darauf, nach München zu fahren und die Stadt wieder richtig zu genießen. Das wird dann etwas Besonderes sein.
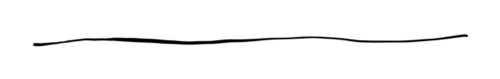
Viktoria Fuchs, 29, Chefköchin im Familienhotel „Spielweg“ im Schwarzwald, begegnet der Krise mit Kreativität und Kampfgeist.

Als im Frühjahr unser Hotel dichtgemacht wurde, war das schon ein Schock. Meine Schwester Kristin und ich führen in sechster Generation unser Landhotel „Spielweg“ im Schwarzwald, die Existenz unserer ganzen Familie hängt daran, viele unserer Mitarbeiter arbeiten länger dort, als ich lebe. Doch den Kopf in den Sand zu stecken, ist nichts, das wir befürworten würden. Wir verkriechen uns nicht im Keller und erzählen uns gegenseitig, wie schlecht es uns geht, sondern schauen lieber nach anderen Wegen und Konzepten.
Während des Lockdowns hatten wir auf einmal Zeit, Sachen anzugehen, die wir schon ewig machen wollten. Wie etwa, unseren Onlineshop auf eine gescheite Ebene zu bringen. Das haben wir mit einigen Nachtschichten in einer Woche hinbekommen. Und unser Hotel wurde vorübergehend zu einer anfangs noch ziemlich chaotischen Manufaktur. Wir haben eine Bestellliste an unsere Stammgäste geschickt, sie auf Facebook und Instagram gepostet – mit hausgemachter Wurst, Bergkäse, Marmeladen und Bärlauchpesto. Wir mussten sofort in Serienproduktion gehen, um die große Nachfrage bedienen zu können. Nachts wurde Bauernbrot gebacken, Papa hat mit den Azubis Hirsch-Leberwurst gemacht. Bis wir auf PayPal und Paketdienst umstellten, brachte Mama Hunderte Pakete zur Post und schrieb Rechnungen.
Damit zusätzlich ein bisschen Kohle reinkommt, hatten wir eine außergewöhnliche Idee:
„Meine Schwester hat mich als Cateringköchin meistbietend bei eBay versteigert.“ -
Das hat tatsächlich super geklappt: Für 3.260 Euro ersteigerte ein Gourmet aus Freiburg ein Vier-Gänge-Dinner für zehn Personen. Außerdem haben wir ein richtig tolles Kochbuch mit dem Titel „Fuchsteufelswild“ produziert, das gerade abgeht. Dieser Aktionismus hat uns sehr geholfen, nicht in eine Starre zu verfallen, sondern immer etwas tun zu können – auch wenn es natürlich nicht die wegfallenden Einnahmen ausgleichen konnte. Es war auch schön, mal Zeit mit allen zusammen zu haben, was in einem Familienbetrieb sehr selten möglich ist. Aber ein leeres Hotel, das fühlt sich trotzdem nie gut an, es lebt eben erst durch die Gäste.
Zum Glück hatten wir einen tollen Sommer, weil wirklich viele das gemacht haben, was auch vorausgesagt wurde: Sie sind im eigenen Land gereist und wir hatten sehr viele junge Leute da, die vorher noch nie im Schwarzwald waren und es richtig cool bei uns fanden.
Mit einem zweiten Lockdown hätten wir allerdings nicht gerechnet. Klar, wir müssen es nehmen, wie es kommt, aber dass nun auch noch das Weihnachtsgeschäft wegbricht, das tut uns schon weh. Immerhin sind wir jetzt eingespielter, was unseren Onlineshop angeht. Gerade sind die Adventskalender verschickt, jetzt arbeiten wir an Weihnachtsplätzchen und Marmeladen, einer Fonduebox mit hauseigenem Käse.
Wir sind nicht mehr so panisch wie beim ersten Mal, nehmen es etwas gelassener, aber ruhig bist du natürlich nie, wenn dein Hotel zu ist. Zum Glück tragen meine Schwester und ich aber nicht allein die Verantwortung auf unseren Schultern. Es ist bei uns nicht so, dass unsere Eltern uns im Nacken sitzen und sagen: „Wehe, ihr vermasselt das!“ Die sind ja auch noch beide voll dabei, sogar die Oma, wir bestimmen ganz viel zusammen im Familienrat und machen dadurch eben auch die Fehler gemeinsam.
Unser Hotel gibt es seit 1861, es hat zwei Kriege überlebt. Und als mein Vater vor fünf Jahren sehr krank wurde und meine Schwester und ich von heute auf morgen den Betrieb übernahmen, war auch das eine große Herausforderung, die wir zusammen super gemeistert haben. Das wird auch bei dieser Krise so sein. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn alle unsere Mitarbeiter wieder zurückkommen und es wieder mit voller Kraft voraus geht.
Scarlett Hettwer und Philipp Sapp, 41 und 43, leiten als Geschwisterteam eine Firma und konnten sich vor Aufträgen plötzlich kaum noch retten.

Für viele Unternehmen war 2020 ein besonders herausforderndes Jahr und exakt so haben auch wir es erlebt: herausfordernd. Aber nicht weil wir um unsere Existenz fürchten mussten wie so viele andere Selbstständige, sondern weil wir auf einmal so viel zu tun hatten wie nie zuvor.
Unsere Firma Setpoint betreibt die Marke MeineWunschleuchte mit fast 10.000 verschiedenen Leuchten, außerdem sind wir ein Online-Elektromarkt: Rauchmelder, Alarmanlagen oder Haushaltsgeräte sind bei uns zu haben. Dass uns die Krise so massiv betreffen würde, hatten wir nicht erwartet: Vor allem die erste Lockdown-Phase stellte im wahrsten Sinne einen Kampf dar – wenn auch im positiven. Quasi über Nacht schnellten die Aufträge und Kundenanfragen in die Höhe – besonders, weil die stationären Märkte geschlossen waren. Das war natürlich toll, aber es gab eben auch keine Möglichkeit, sich in Ruhe auf diesen Ansturm einstellen zu können. Wir mussten auf einmal Entscheidungen viel schneller treffen, mehr wagen, schnell unser Team vergrößern. Wir haben aus dieser Zeit gelernt: Es gibt Situationen, die man sich nicht vorstellen kann. Muss aber damit umgehen.
„Es war schön zu sehen, wie Herausforderungen ein Team zusammenschweißen können.“ -
Selbst oder gerade in Zeiten, in denen ein direktes „Zusammen“ schwierig oder gar nicht möglich ist, weil viele im Homeoffice sind. Es gab auf einmal lange Arbeitstage, ein hohes Tempo, aber alle haben mitgezogen und signalisiert: „Komm, das schaffen wir!“
Auch wenn es das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte war, ein einfaches war es sicher nicht. Wenn wir auf diese Zeit zurückblicken, entsteht da sofort ein Bild aus dem April im Kopf, das ganz gut dieses Gefühl beschreibt, das wir damit verbinden: Wir haben gerade einen ganzen Container Ware erhalten, richten draußen im Hof Packplätze ein, weil es drinnen aus allen Nähten platzt, und arbeiten mit dem gesamten Team Aufträge ab. Am Ende gibt’s völlig erschöpft für alle eine Eiszeit und man denkt: „Wow, wenn es heute geregnet hätte, wären wir aufgeschmissen.“ Ein wenig ehrfürchtig schauen wir auf das Jahr zurück. Und mit riesiger Dankbarkeit. Wir denken so oft an all diejenigen, die vor Angst um ihre Existenz wahrscheinlich fast verrückt werden und sich in Umständen befinden, die einem die Luft zum Atmen nehmen. Wir sind dankbar dafür, gerade nicht in dieser Situation zu sein.
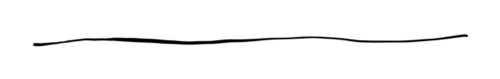
Lena Schindler, 42, brachen als freier Journalistin die Aufträge weg – doch es öffneten sich ganz unerwartet neue Türen.

Ich erinnere mich, wie ich mich im Februar noch über meinen Mann lustig machte. Er hat beruflich viel mit Asien zu tun, die Auswirkungen von Corona erreichten ihn früher als die meisten hier. Und er benutzte zu der Zeit schon so exzessiv Desinfektionsmittel für die Hände, dass sie rissig wurden und er meine Handcreme aufbrauchte. Ich fand das alles übertrieben und nahm es nicht wirklich ernst. Auch als die Einschläge näher kamen, hätte ich nicht erwartet, dass mich die Krise so stark betreffen würde. Doch tatsächlich brachen mir als freier Journalistin nach und nach 80 Prozent der Aufträge weg. Das Anzeigengeschäft der Verlage lief nicht mehr, für Freiberufler gab es während des Lockdowns kaum noch Jobs. Keine existenzbedrohende Situation, nein, denn ich stehe nicht alleine da, aber trotzdem: Bitter, denn ich fürchtete um das, was ich mir in fünf Jahren Selbstständigkeit aufgebaut hatte.
Nach der ersten Lähmung beschloss ich, das nicht hinzunehmen, sondern statt auf bessere Zeiten zu warten, Dinge zu tun, die ich vorher noch nie gemacht hatte, die sich finanziell oft kaum oder gar nicht lohnten, aber sich vielleicht ja langfristig auszahlen würden – wer konnte das schon wissen? In den Stunden, in denen die Kinder mal keine Schneise der Verwüstung durch unsere Wohnung zogen (also nachts), schrieb ich an einem Krimi, was ich schon immer tun wollte und nie gebacken bekommen hatte. Ein positiver Nebeneffekt war, dass es mir half, den mütterlichen Frust, der sich in häuslicher Isolation aufbaute, wiederum abzubauen. Ich schrieb über Medizinthemen (sonst nicht gerade mein Spezialgebiet) und den Text für ein Kinderbuch, das unsere Babysitterin, die Illustration studiert, gerade entwickelte.
Als mich eines Tages die Anfrage eines Freundes erreichte, ob ich mir vorstellen könnte, erotische Kurzgeschichten zu verfassen, sagte ich „Ja“, obwohl ich mir eigentlich nichts weniger vorstellen konnte als das. Als es dann ans Eingemachte ging und ich anfing zu schreiben, stellte ich fest, was man so oft tut, wenn man seine Komfortzone verlässt:
„Am Anfang tut’s ein kleines bisschen weh, man windet und überwindet sich.“ -
Und dann wird man belohnt mit Erleichterung (Ich kann das ja doch!) und in diesem Fall: sehr viel Spaß. Nein, nicht weil ich meine Sexgeschichten selbst so mitreißend fand. Sondern weil ich mich in diesen Tagen, in denen – wenn überhaupt mal einer lachte – es unter der Maske meist nicht zu sehen war, in einem Zustand pubertärer Albernheit befand, der herrlich war. Man konnte mir nichts mehr erzählen, ohne dass ich eine Doppeldeutigkeit darin erkannte. Am Abend saß ich mit einem Glas Wein auf dem Sofa und dachte über Synonyme für Geschlechtsteile nach. Das war in den Tagen dieser seltsamen Schwere so lustig und leicht, dass es eigentlich schon der beste Lohn war. Tatsächlich ergab sich aber über diesen Kontakt ein toller Auftrag für ein Buchprojekt, über den ich mich riesig freue (Nein, es gibt keine thematischen Parallelen!) und mit dem ich nie gerechnet hätte.
Für mich endet dieses herausfordernde Jahr zwar mit einem Gefühl von: Boah, war das anstrengend! Aber auch mit der positiven Erfahrung, dass sich Türen öffnen, wo man nicht mal welche gesehen hat. Und dass es sich lohnt, wenn man seinen sicheren Hafen verlässt – auch wenn man es erst mal nicht ganz freiwillig tut.
Fotos: Marco & Patrick Gaffrey: Janine Oswald Kathrin Willhöft, Lena Schindler sowie Scarlett Hettwer und Philipp Sapp: privat Viktoria Fuchs: Familienbild von Sebastian Fuchs, alle anderen von Vivi d`Angelo

Abo abschließen, um Artikel weiterzulesen
Endlich Ich - Abo
6,90€
Alle Artikel lesen, alle Podcasts hören
4 Wochen Laufzeit, monatlich kündbar
Digitaler Goodie-Bag mit exklusiven Rabatten
min. 2 Live-Kurse pro Woche (Pilates, Workouts, etc.)
Bereits Abonnent? Login