Diese Website benutzt technische Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.
Gefühle & Gedanken
Zurück an die Uni
Alexa ist dank eines kostenlosen Onlinekurses jetzt Yale-Absolventin zum Thema Wohlbefinden. Sie hat gelernt, wie man das nachhaltig steigert.
von Alexa von Heyden - 01.07.2023

Audioartikel

Die Audiodatei gibt es hier als Download.
Mit Beginn der langen Sommernächte und Blick auf ein Lagerfeuer im Garten denke ich mehr nach als sonst. Also noch mehr. Ich bin eine Frau Mitte 40, die großen Themen des Lebens wie Karriere, Kinderwunsch und Hauskauf liegen hinter mir. Was macht mich jetzt und in Zukunft glücklich? Also bis in die Körperzellen kribbelig erfüllt, nicht nur kurz berauscht von einem instagramtauglichen Urlaub auf Antiparos oder eine Bottega-Veneta-Tasche mit einem Henkel in Form einer goldenen Sardine? Und vor allem: Wie gelingt es mir, dass mir das Glücksgefühl in meinem Alltag, der an sich ja alles andere als schlecht ist, nicht wieder flöten geht, so wie mein Schlüssel, den ich andauernd verlege?
Es kam der Zeitpunkt, an dem ich merkte, dass ich mehr Futter für mein Gehirn brauchte. Im Internet suchte ich Antworten auf meine Fragen und fand: „The Science of Well-Being“, die Wissenschaft des Wohlbefindens, ein Onlinekurs der Yale-Universität. Es ist ein Spin-off von „Psychologie und das gute Leben“, dem erfolgreichsten Kurs in der 300-jährigen Geschichte der Elite-Uni.
Als die Vorlesung aufgrund der Coronapandemie nicht mehr stattfinden konnte, die Nachfrage im Lockdown parallel aber immer größer wurde, wurde daraus eine Onlineversion entwickelt.
Wobei man heute sagen muss: Es ist DER Onlinekurs. Vier Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben ihn bereits absolviert. Der riesige Erfolg des Yale-Kurses zu Coronazeiten beweist: Kostenlose Unterstützung für die mentale Gesundheit kann online super funktionieren, wenn das Angebot wissenschaftlich fundiert und durch aktuelle Studien gestützt wird. Aufgrund des Mangels an Therapieplätzen ist das für viele Menschen ein Silberstreif am Horizont. Aber auch ich wusste, als ich „Yale“ und „Wohlbefinden“ las, sofort: Das will ich auch.
An einer der besten Unis der Welt lernen, wie man ein glückliches Leben führt: Das ist doch was! Mein Gedanke: Wenn ich diesen Kurs abgeschlossen haben würde, dann könnte ich die immer wiederkehrenden Zweifel über meinen Lebensweg über Bord schmeißen und wüsste ein für alle Mal Bescheid, wie der Hase läuft.
„„Wir alle wollen glücklich sein. Die Wissenschaft kann uns helfen, dort hinzukommen“,“ -
sagt die Psychologin Dr. Laurie Santos, die den Kurs leitet. „Das Problem ist, dass wir falsche Vorstellungen davon haben, was uns glücklich macht. Wir glauben immer, dass wir unsere Lebensumstände grundsätzlich ändern müssen, dabei können kleine Änderungen in unserem Verhalten oder unserer Denkweise einen großen Unterschied machen, wie wohl wir uns fühlen.“
Was mich an diesem Zitat als Journalistin ansprach, war, dass mir in diesem Kurs kein toxisches „Denk positiv“-Gesülze serviert werden würde oder esoterische Quantensprünge dank der Pluto-Venus-Konjunktion versprochen wurden. Sondern dass es hier um Hard Facts mit Studiennachweis in den Fußnoten geht. Also valide Glücksinformationen, kein Hokuspokus.
Mehrere Wochen war ich eine von Dr. Santos Student*innen und hatte Zugang zu allen Unterrichtsmaterialien – zwar nur virtuell, aber dennoch so nachhaltig, dass sich wirklich etwas verändert hat. Und zwar in mir.
„Das ist kein gewöhnlicher Kurs, sondern eine Reise, die dein Leben verändern kann“, bestätigt Dr. Santos.
Na gut, ich gebe zu: Natürlich wollte ich auch das angeberische Abschlusszertifikat in einem Rahmen an meiner Homeoffice-Wand hängen haben. Das kostet eine Extragebühr, trotzdem musste ich mich reinhängen, denn schummeln kann man in dem Kurs nicht.

Das wäre auch schade. In zehn Modulen mit Theorie- und Praxisteil erläutert die lockenköpfige Dr. Santos gut gelaunt und anschaulich ihren Student*innen anhand von Studien und Statistiken, was die Wissenschaft über Zufriedenheit und Wohlbefinden weiß. Sie interviewt Expert*innen, dazu gibt es pro Modul einen Abschlusstest und Hausaufgaben.
Oft war der Kurs mehr Therapie als Weiterbildung. Zu Beginn galt es, einen Test zu machen, wie glücklich ich mich selbst gerade fühle. Das Ergebnis war in Bezug auf meine Gesundheit gar nicht so schlecht, aber zwei Punkte fielen auf: wenig soziales Engagement und große Einsamkeit.
Hatte ich damit etwas mit der Handvoll junger Student*innen gemeinsam, die vor Dr. Santos in der Vorlesung saßen? Anfang 20 habe ich nie infrage gestellt, dass ich glücklich werde. Aber die Welt hat sich verändert. Laut Statista sagen beispielsweise nur 46 Prozent der Menschen in Deutschland, dass sie glücklich sind. Dabei können wir hier, im Vergleich zu anderen Ländern, doch ein wirklich gutes Leben führen. Warum haben wir trotzdem das Gefühl, im Regen zu stehen?
Egal, wo wir leben und wie alt wir sind: Es gibt, wie von Dr. Santos erwähnt, in unserer Gesellschaft ein großes Missverständnis darüber, was Glück bedeutet. Wir glauben, dass wir glücklich sind, wenn wir gute Noten bekommen, einen begehrten Job ergattern, viel Geld verdienen, teure Dinge kaufen können, unsere große Liebe heiraten, ein schönes Haus bauen, viele Kinder bekommen und on top den „perfekten“ Körper haben.
„Das ständige Streben nach diesem falschen Glück macht uns unglücklich, weil viele dieser Dinge schlichtweg außerhalb unserer Reichweite liegen.“ -
Wir kommen niemals dahin. Das sollen wir auch gar nicht. Der patriarchalische Kapitalismus will, dass wir funktionieren und konsumieren, nicht fühlen oder etwas infrage stellen.
Von einer Professorin für Psychologie zu hören, dass sich unser Empfinden von Glück in anderen Dingen als Status, Besitz und Schönheit bewahrheitet, hatte für mich persönlich viel Gewicht. Tatsächlich belegen viele Studien, dass wir uns beispielsweise nachweislich länger glücklich fühlen, wenn wir Geld für andere ausgeben oder an Bedürftige spenden, als uns selbst mit einem neuen Kleid für einen Scheißtag im Büro zu entschädigen.
Das ist an sich nichts Neues. Die Krux daran ist: Wir wissen, was uns guttut, und tun trotzdem das Gegenteil. Wir schlafen zu wenig, machen keinen Sport und zappen auf der Couch, anstatt uns mit einer Freundin an einem lauschigen Sommerabend auf eine Schorle zu treffen.
Für dieses Phänomen gibt es einen Namen: der „G.I. Joe-Irrtum“. In den USA gibt es eine Serie für Kinder, in denen eine Actionfigur namens G.I. Joe über gefährliche Situationen aufklärt. Kinder sollen aufmerksames Verhalten im Straßenverkehr lernen und wie sie Gefahren vermeiden können. Der letzte Satz einer jeden Folge lautete: „Jetzt wisst ihr Bescheid. Und Wissen ist die halbe Miete.“
Das stimmt nicht. Denn wir wissen, dass frisches Gemüse gesund ist, und essen trotzdem Tütensuppe. Wir wissen, dass Sport eine große Menge an Endorphinen freisetzt, hocken aber mit Erdnussflips auf der Couch. Wir wissen, dass eine Beziehung für uns toxisch ist, und trennen uns trotzdem nicht.
Wenn wir etwas in unserem Leben ändern möchten, reicht es also nicht, dass wir uns über die Vorzüge dieser Veränderung in Ratgebern, Podcasts oder Coachings informieren. Der Weg zum Glück führt jeden Tag über den Rücken des inneren Schweinehunds hinweg, um unser persönliches Glückslevel zu steigern und produktive Gewohnheiten aufzubauen.
Das Fazit des Kurses lautet:
„Man muss Wohlbefinden üben, weil Glück niemals ein Dauerzustand sein kann.“ -
Glück ist immer wieder eine neue gute Entscheidung für sich selbst. Sekunde für Sekunde, Woche für Woche und Jahr für Jahr.
Die Hausaufgaben von Glücksexpertin Dr. Santos sind deshalb auch keine Essays oder Referate, sondern Übungen für „Rewirements“, also Neuverkabelungen im Gehirn. Auszeiten von Social Media, regelmäßige Sporteinheiten, Meditation, ausreichend Schlaf, Quality Time mit Herzensmenschen, Freundlichkeit, Genuss und Dankbarkeitsübungen sorgen dafür, dass wir uns wohlfühlen und automatisch mehr Glück empfinden.
Ich persönlich schrieb als Hausaufgabe unter anderem einen Dankesbrief an Floris Oma, die mir seit sechs Jahren bei der Erziehung meines Kindes hilft. Meine Tochter kommt jetzt in die Schule. Damit endet ein Kapitel für mich als Mutter und sie als Oma. Zum Schluss saß ich heulend über dem Stück Papier und war von mir selbst ergriffen. Dieser Brief war so überfällig und beflügelte unsere ohnehin schon gute Beziehung über Wochen hinweg. Beim Yoga übersprang ich nicht mehr die Schlussentspannung, sondern genoss das Savasana bis zum letzten Atemzug und stellte fest, wie zufrieden ich in den Tag ging. Ich ging ohne Handy in der Tasche mit meiner Tochter auf den Spielplatz und verstand endlich die Spiele, die sie spielte. Ich lud meine Mutter in die Sommerferien ein, machte der Frau an der Supermarktkasse ein Kompliment für ihre Frisur und schickte meinem Bruder endlich die Fotoabzüge, die er seit Wochen haben wollte. Und siehe da: Meine Scores in Sachen soziales Engagement und Einsamkeit verbesserten sich, indem ich mehr Zeit in meine Beziehungen investierte.
Diese These stützt eine weitere Studie: Seit 85 Jahren begleiten die Wissenschaftler*innen der Harvard University, der anderen großen Kaderschmiede der USA, knapp 2.000 Menschen aus drei Generationen, um ebenfalls herauszufinden, was das Wohlbefinden des Menschen positiv beeinflusst.
Die „Harvard Study of Adult Development“ startete 1938. Damals galt der Fokus als revolutionär, weil sich die Wissenschaftler*innen bei ihrer Arbeit nicht auf die Dinge, die Menschen krank machen, konzentrieren, sondern auf jene, die gesund und glücklich machen.
Die Ergebnisse haben die Studienleiter Robert Waldinger und Marc Schulz dieses Jahr in ihrem Buch „The Good Life ... und wie es gelingen kann: Erkenntnisse aus der weltweit längsten Studie über ein erfülltes Leben“, ein New York Times-Bestseller, veröffentlicht.
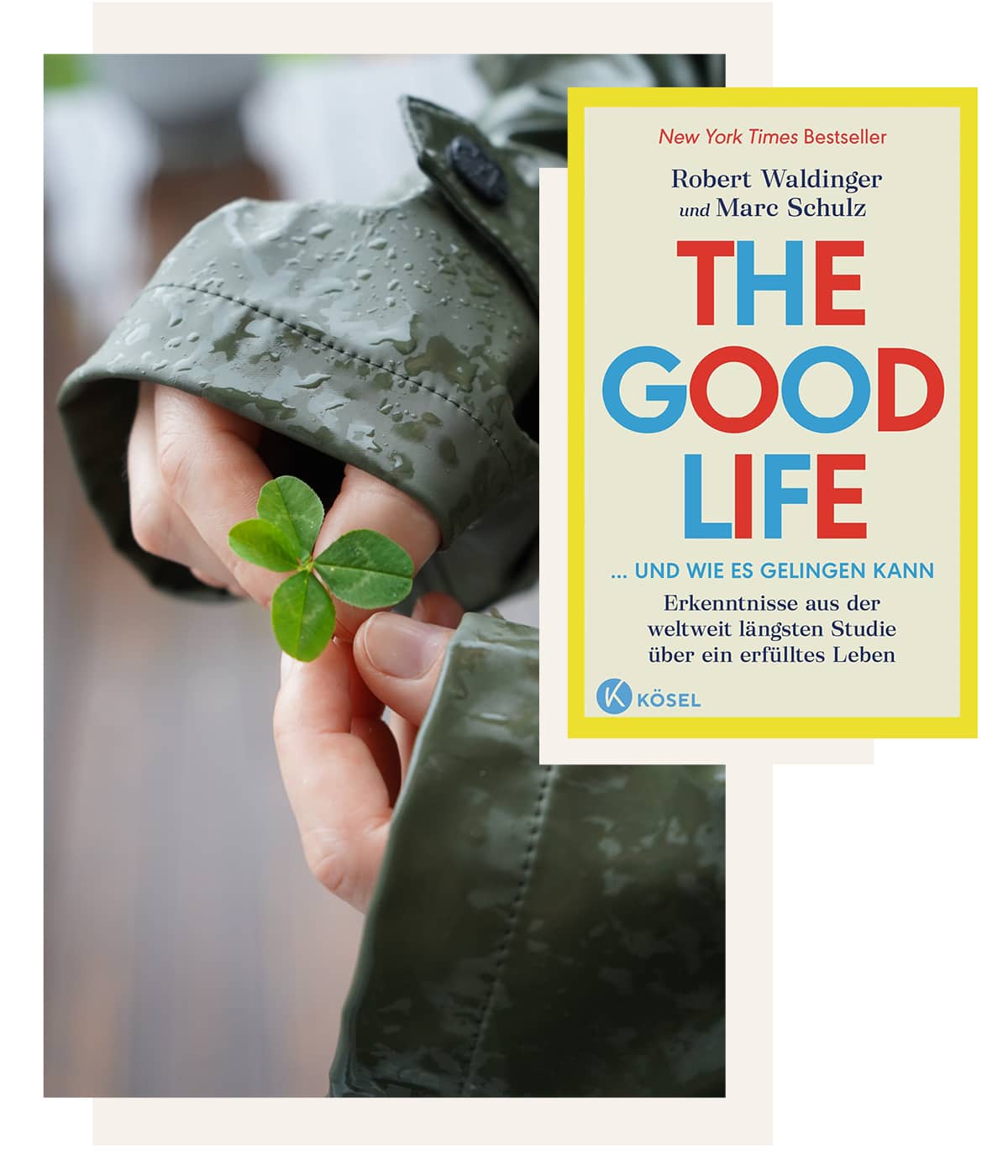
Auch wenn die Bedürfnisse eines jeden Menschen mehrblättrig wie ein Kleeblatt sind, haben die Forscher in der Auswertung einen Faktor gefunden, der sich als Schlüssel für ein glückliches Leben herausstellt: Materielle Güter, Geld oder Erfolg im Beruf seien zwar nicht unerheblich, doch den Unterschied machten vor allem all die Beziehungen, in denen man sich geliebt, unterstützt und wertgeschätzt fühle.
Die Forscher empfehlen deshalb, ebenso wie Dr. Laurie Santos in ihren Neuverkabelungen, den „sozialen Muskel“ zu trainieren. Also nicht nur die Beziehungen zu Familie und Freund*innen zu pflegen, sondern auch zu Nachbar*innen und Kolleg*innen. Selbst Zufallsbegegnungen oder ein Plausch mit der alleinstehenden Nachbarin oder dem Barista im Lieblingscafé können unser Wohlbefinden nachhaltig steigern.
„Was uns also glücklich macht, sind authentische und ehrliche Erfahrungen.“ -
„Muss man für diese Erkenntnisse an einer Elite-Uni studieren?“, fragte ich mich. Ja, denn egal wie schwierig eine Situation sein mag: Wir haben oft immer noch eine gewisse Entscheidungsfreiheit und damit die Möglichkeit, unserem Glück einen Stups zu geben.
Ein Stups kann so funktionieren: Dr. Laurie Santos interviewte Gabriele Oettingen, Professorin für Psychologie an der New York University und an der Universität Hamburg. Ihre Forschung befasst sich mit Zukunftsdenken und Selbstregulation.
Oettingen hat eine wissenschaftlich fundierte mentale Strategie entwickelt, mit der Menschen ihre Wünsche finden, sich erfüllen und ihre Gewohnheiten ändern können: WOOP. Das ist eine Abkürzung für die englischen Begriffe Wish, Outcome, Obstacles und Plan. Also Wunsch, Ergebnis, Hindernisse und Plan.
Gabriele Oettingen sagt, Woop sei wie ein Fahrrad oder Hammer ein Werkzeug, um besser im Leben zurechtzukommen. Ein Helfer in allen Lebenslagen. Zu woopen hat sich in vielen Studien mit Menschen aller Altersgruppen bereits als wirksam erwiesen. Demnach gibt es vier Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man sich eine Veränderung in seinem Leben wünscht:
- Was ist dein Wunsch?
- Was wäre das Schönste, wenn du dir diesen Wunsch erfüllen würdest?
- Welche Hindernisse halten dich davon ab, deinen Wunsch zu erfüllen?
- Was kannst du tun, um die Hindernisse zu überwinden?
Ich schwang den Hammer und woopte eine herausfordernde, aber machbare Idee, die mir seit einiger Zeit durch den Kopf ging, wie meine Zukunft aussehen könnte. Was mich bislang immer davon abhielt, diesen Schritt zu machen, war ein Hindernis in meinem Kopf: Ich empfand mich in dem Bereich nicht als Expertin.
Diesen Konflikt sprach ich bei meinem nächsten Coaching an. Eine Stunde später war mir klar: Ich habe zwar keinen Doktortitel, verfüge aber über jede Menge angewandtes Wissen, was mich auch zu einer Expertin macht.
Sich an die eigene Kraft bei der Gestaltung seines Lebens zu erinnern, kann also einen großen Unterschied machen. Einen, der sich ziemlich gut anfühlt, wie ich finde. Das chice Zeugnis an der Wand erinnert mich täglich daran.
Der Kurs The Science of Well-Being wird von der Online-Weiterbildungs-Plattform Coursera kostenfrei auf Englisch mit einer Laufzeit von 10 Wochen angeboten. Ein Endzertifikat kann zusätzlich für ca. 40 Euro erworben werden.

Abo abschließen, um Artikel weiterzulesen
Endlich Ich - Abo
6,90€
Alle Artikel lesen, alle Podcasts hören
4 Wochen Laufzeit, monatlich kündbar
Digitaler Goodie-Bag mit exklusiven Rabatten
min. 2 Live-Kurse pro Woche (Pilates, Workouts, etc.)
Bereits Abonnent? Login